Evolution des Internets: Wie Smartspheres analog-digitale Erlebnisräume für Zielgruppen schaffen
Auch wenn es vielen noch nicht bewusst ist: Die nächste Stufe der digitalen Evolution ist bereits da, und dieses Mal verdient sie eher die Bezeichnung „Revolution“. So sind die Menschen mit dem Erwachsenwerden der Smartphones und der Integration sogenannter „Location Based Services“ weder an stationäre oder tragbare Rechner gebunden noch nutzen sie einzelne Angebote, um in ihrem sozialen Umfeld zu kommunizieren. Sie haben kleine Hochleistungsrechner (Smartphones) mit integrierten, individualisierten und miteinander komplex vernetzten Medien- und Kommunikationsplattformen in der Hosentasche, die sich mit kleinsten und tragbaren Erweiterungen wie Kopfhörer, Smartwatches, Datenbrillen etc. und via WLAN, Bluetooth, GPS, NFC, QR-Code, Mustererkennung etc. mit ortsgebunden digitalen Angeboten verbinden und somit in der Bewegung, im Raum, den Austausch von Informationen in eine neue Dimension katapultieren.
Eine Ausbaustufe dieser ebenso rasanten wie spannenden Entwicklung ist das Konzept der auch für Unternehmen interessanten „Smartspheres“, die ich in diesem Beitrag vorstellen möchte.
Doch blicken wir zunächst einmal kurz zurück: In den vergangenen 25 Jahren seit der Entstehung des Internets, erlebten wir eine Entwicklung der digitalen Angebote für den privaten Nutzer, die sich in vier Stufen darstellen lässt:
Stufe 1: Web 1.0
Professionelle Webseiten werden zur Informationsvermittlung von privaten Nutzern aufgerufen (Einbahnstraßen-Kommunikation).
Stufe 2: Web 2.0
Webseiten sind interaktiv.
Moderne „Content Management Systeme“ erlauben auch privaten Nutzern den günstigen Unterhalt eigener Angebote.
„Social Media“-Angebote verwandeln den privaten Nutzer in einen Medien-Produzenten (ProdUser) und vernetzen ihn.
Stufe 3: Social Web
„Social Media“ und „Mobile Web“ verschmelzen miteinander.
Stufe 4: Social Sphere
Der Nutzer und der Ort, an dem er sich befindet, werden durch ortsgebundene Dienste und Technologien miteinander verknüpft. Hierbei spielen sowohl „Social Media“- und „Internet of Things“-Angebote als auch automatisierte Lösungen (wie z. B. Chatbots und Sprachassistenten) eine wichtige Rolle.
Die Zusammenführung von Smartphones, Social Media und ortsgebundenen Diensten zu einem Smartplace (interaktiver Ort) oder einer Smartsphere (interaktiver Raum mit Schnittstellen zu vielen Smartplaces) verlangt von Anbietern digitaler Inhalte ein neues Verständnis der Zusammenhänge zwischen Usern und Informationen.
Bisher beschränkt sich das Hineindenken in diese neuen Angebote zumeist auf technische Lösungen. Unternehmen bieten hier und da ortsbasierte Dienste an, die Informationen liefern, ohne dass der User sie suchen muss. Weginformationen werden in Echtzeit geliefert und Routen angepasst. QR-Codes erweitern Flyer und Poster.
Doch muss man wissen, dass sich mit diesen Angeboten kostengünstige Lösungen entwickeln lassen, die nachhaltig nutzbar, ausbaubar und wesentlich effektiver sind als heutige transmediale Erzählstrategien. Sie erschaffen nämlich nicht nur für Nutzer einen einfachen Zugang, sondern liefern auch die Grundlage dafür, dass diese Nutzer sich langfristig und engagiert in eigens für sie geschaffenen Sphären aufhalten und dort Inhalte, Nutzungszeit und Traffic produzieren.
Wie Orte analog-digital erlebbar werden
Wie muss man sich eine Smartsphere vorstellen? Um das besser zu verstehen, schauen wir uns ihre Entwicklungsgeschichte einmal etwas näher an.
Schon seit 2012 plant man in der ortsgebundenen Projektproduktion mit dem Konzept der Smartplaces. Ein Smartplace kann z. B. ein Museum, ein Stadion, ein Festival sein. Nötig ist dafür ein Konzept, das den Ort und das Event mit seinen Besuchern interagieren lässt. Und bereits seit 2014 sprechen Experten, die sich mit dieser Art der Schnittstelle zwischen Menschen, Orten und Web-Technologie beschäftigen, von einem „analog-digitalen Erlebnisraum“. Gemeint ist damit die technisch-kommunikative Erweiterung analoger Gegebenheiten (eine Stadt, ein Haus, eine Arena, Druckerzeugnisse, Koordinaten …) um digitale Elemente wie ortsbasierte Dienste, Augmented Reality, Virtual Reality, Beacons, Chatbots usw. und deren strategischer Einsatz zur Information und Kommunikation.
Ein aktuelles und sehr erfolgreiches Beispiel für die Nutzung dieses analog-digitalen Erlebnisraums ist das im Juli 2016 veröffentlichte Smartphone-Spiel Pokémon Go. Darauf werde ich weiter unten zurückkommen.
Im US-amerikanischen und asiatischen Raum spricht man bereits davon, dass diese Angebote Websites auf eine reine Visitenkarten-Funktion reduzieren werden und auch soziale Netzwerke dadurch enorm an Nutzungszeit verlieren, wenn sie diesen Trend nicht auf die eine oder andere Weise integrieren.
Beobachtet man heute den aktiven Nutzer des mobilen Internets, bezieht er immer öfter den Ort, an dem er sich befindet, in die Interaktion mit ein. Am einfachsten wird das sichtbar, wenn man sich einmal die Besucher eines Bundesliga-Spiels anschaut: Steht man unter Fans, ist der Gebrauch von Smartphones als multimediale Dokumentationshilfe und Informationszentrale für die interne und externe Verarbeitung üblich. Dabei werden alleine während eines Fußballspiels Unmengen an Daten und Medien verbreitet. Ein Beispiel: An einem einzigen Bundesliga-Wochenende kommt der BVB Dortmund auf rund 120 Millionen Impressions/Kontakte – und dies alleine auf Twitter (Stand 07.-08.02.2015). Das bedeutet einen Internet-Traffic, den alle Zeitungen in Deutschland zusammen nicht erreichen.
Neue Möglichkeiten für das Marketing?
Daraus ergibt sich eine entscheidende Frage:
Wenn die Menschen sich selbst analog-digitale Erlebnisräume erschließen und aufbauen und bereit sind, entsprechende Angebote begeistert zu nutzen, warum kommen die Inhaber dieser Orte ihnen nicht entgegen und entwickeln eigene Strategien, um diesen Traffic und die erstellten Medien für ihre Besucher, aber auch für das eigene Marketing und die Optimierung des Angebots einsetzen zu können?
Bisher wird dieser gigantische Daten- und Medien-Strom von Stadien, Festivals, Shopping-Malls, Innenstädten, Museen, Theatern, ja, von allen Orten, an denen sich Menschen treffen und via Internet darüber berichten, bestenfalls rudimentär genutzt und betreut. Oftmals geht er sogar völlig verloren.
Doch es gibt bereits funktionierende Konzepte, wie das angegangen werden sollte, und kommunikativ-technische Lösungen, wie ein analog-digitaler Erlebnisraum angeboten werden kann. Diese Konzepte können als Smartplace und Smartsphere bezeichnet werden.
Smartplace
Smartplaces sind nicht nur technisch-kommunikative Interaktionslösungen in Form einer App, sondern beinhalten auch Strategien und agile Optimierungen für „Social Marketing“-Aktivitäten. So wurde bereits 2012 erstmalig die technisch-kommunikative Grundlage eines Smartplaces theoretisch für ein Bundesligastadium erarbeitet und 2014 erstmals als App-Lösung während eines Musik-Festivals getestet.
Ein Smartplace kann ein Stadion, Gebäude, eine Fläche (Park, Stadtteil …), aber auch ein zeitlich begrenztes Event sein.
Ortsbasierte Dienste und Technologien
Für einen Smartplace und die dazugehörige App haben sich bisher drei Techniken herauskristallisiert, die den Ort und den Nutzer interagieren lassen: GPS, QR-Code, Beacon. Streng genommen müsste man an dieser Stelle als Technik noch die Augmented-Reality erwähnen. Diese wird aber weiter unten im Bereich der Apps behandelt – der Grund besteht darin, dass bei der AR unbedingt ein Gerät, eine App oder eine Datenbrille wie Google Glass oder die Oculus Rift vorhanden sein muss.
Die älteste Technik davon dürfte die GPS-Ortung sein, die sich mittlerweile als Standard vor allem für die Umgebung durchgesetzt hat. Das Problem: Eine garantiert einwandfreie Positionsbestimmung ist bei GPS nicht möglich – Abweichungen können um bis zu mehrere Dutzend Meter betragen.
QR-Codes sind mittlerweile aus dem Marketing nicht mehr wegzudenken. Der Benutzer des Smartphones muss dafür einen passenden Reader für die QR-Codes installiert haben und wissen, wie man den QR-Code nutzt. Wichtig ist vor allem, dass der Inhalt, der sich hinter dem QR-Code verbirgt, für das Smartphone angepasst sein muss.
Relativ neu als Technik sind Beacons. Apple stellte diese Technik im Juni 2013 vor. Mit Beacons werden die Defizite des GPS-Systems innerhalb von Räumen behoben: Die kleinen Sender sind im wahrsten Sinne des Wortes „Leuchtfeuer“ – sie strahlen innerhalb von 30 Metern Signale ab. Dabei findet allerdings kein bidirektionaler Datenaustausch statt. Die Beacons strahlen stattdessen erstmal nur permament Signale aus.
Standortbezogene Dienste – die Location Based Services (LBS) – sind mit Diensten wie Gowalla, Foursquare/Swarm oder den entsprechenden Funktionen in Sozialen Netzwerken wie Facebook bekannt geworden. Hinter der Bezeichnung LBS stehen dabei Dienste und Technologien, die unter Zuhilfenahme von positionsabhängigen Daten dem Endbenutzer selektive Informationen bereitstellen oder Dienste anderer Art erbringen.
Apps
Ohne Apps, die die Signale von Beacons abfangen und an die Smartphones ausspielen, die die Signale von GPS-Satelliten empfangen und die QR-Codes auslesen, wäre ein Smartplace nicht umsetzbar. Dabei wird es in der Regel so sein, dass der Smartplace eine App besitzt, die alle wesentlichen Elemente in sich vereint. Diese App kann sowohl GPS-Signale auswerten als auch Beacon-Signale empfangen und darüber hinaus QR-Codes auslesen sowie bei eingescannten Plakatmotiven eine AR-Ebene darstellen. Hier laufen also alle benötigen Elemente in einer App zusammen, die dem Besucher ein intensiveres Erlebnis ermöglichen. Möglich ist aber auch ein Verbund von Apps, die aufeinander abgestimmt sind.
Die Smartsphere als Betriebssystem
Bisher bezogen wir uns mit „Smartplaces“ auf Beispiele für einzelne Lösungen, die technisch und kommunikativ dabei helfen, Orte in analog-digitale Erlebnisräume zu verwandeln und den Anforderungen und Wünschen der Nutzer in der „Social Sphere“ entgegenkommen. Aber eine Stadt besteht aus sehr vielen Orten, sehr vielen Events und Unmengen an sozialen, kulturellen und sportlichen Ereignissen, die heute entweder gar nicht oder nur marginal in der „Social Sphere“ dargestellt werden. Dadurch werden sie vom mobilen Smartphone-Nutzer kaum wahrgenommen, und eine aktive Partizipation, die den aktuellen Verhaltensmustern entspricht, wird mehr als erschwert.
Schaut man sich einmal das Beispiel „Pokémon Go“ an, so stellt man fest, dass es eigentlich kein Spiel im eigentlichen Sinn ist. Vielmehr ist es eine Art Betriebssystem, welches es ermöglicht, unterschiedlichste Angebote in den analog-digitalen Erlebnisraum zu integrieren. Neben dem reinen Spiel finden wir Möglichkeiten, Werbung im Raum anzubieten, Einkäufe zu tätigen, zu interagieren, reale Geschäfte und Örtlichkeiten in das Spiel einzubauen, ja sogar analoge Angebote mit den digitalen Inhalten zu koppeln. Nach und nach wird sich Pokémon Go so zu einer Schnittstelle zwischen allen möglichen Angeboten der analogen Welt in die digitale und umgekehrt entwickeln. Aus dem Spiel wird eine Smartsphere, die es den Anbietern ermöglicht, schnell und kreativ zu reagieren und nicht nur Nutzer intensiver an das Spiel zu binden, sondern Werbung für Produkte und Dienstleistungen direkt und spielerisch in der App anzubieten.
Eine Smartsphere ist somit das technisch-kommunikative „Betriebssystem“ des analog-digitalen Erlebnisraumes, der kommunikativ, multimedial und technisch eine Interaktion und Vernetzung zwischen Social-Web-Nutzern, Besuchern und dem Ort ermöglicht und fördert.
Die Vorteile einer solchen Lösung liegen auf der Hand:
- Geringere Ressourcen (Geld und Zeit) bei der Entwicklung von Angeboten
Die für den Aufbau vieler Smartplaces und „Points of Interest“ (das sind einfache digitale Informations- oder Werbepunkte im analog-digitalen Erlebnisraum) benötigten ortsbasierten Technologien, Dienste und Strategien sind in einer Plattform gebündelt und können kostengünstig von allen beteiligten Content-Anbietern (Handel, Kultur, Sport, städtische Informationen …) immer wieder neu genutzt werden. Das reduziert die Entwicklungskosten solcher Angebote um 60 bis 70 Prozent. - Datensicherheit und Datenhoheit
Ein entscheidender Punkt für die Zukunft der digitalen Werbung ist die Datenhoheit. Schon heute sind Daten die höchste Währung und das wertvollste, aber wenig genutzte „Abfallprodukt“ der Web-/App-Nutzung. Die Wichtigkeit solcher Daten wird mit immer besseren Analysenmöglichkeiten um ein Vielfaches steigen. Das Problem: Nutzen Städte und lokale Anbieter keine eigenen Systeme, können sie weder für den Datenschutz ihrer Bürger und Nutzer garantieren noch von den gesammelten Daten als Stadt profitieren, um ihrer Verantwortung in der Optimierung von gesellschaftlichen Prozessen gerecht zu werden. - Marketing im analog-digitalen Erlebnisraum
Es ist sicher, dass Werbung nicht nur in unserer analogen Welt, in der Städte Werbeflächen an Unternehmen vermieten, digitaler wird. So zeigt das Beispiel „Pokémon Go“, dass in der digitalen Ansicht einer Stadt Werbung ein wichtiger Bestandteil des Nutzer-Lebens sein wird. Dank Augmented Reality ist diese Möglichkeit von Produkt- und Dienstleistungsangeboten eine unterhaltsame und höchst einfache Möglichkeit geworden, Werbung im Raum zu präsentieren und – vor allen Dingen – zu vermarkten.
Smartsphere-Projekte in Deutschland
In Deutschland gibt es einige Ansätze für die intensive Planung und Nutzung von städtischen Smartspheres, die noch in diesem Jahr zur Nutzung zur Verfügung gestellt werden sollen. In den Städten Emden, Bremerhaven und Essen haben sich bereits Teams gebildet, die an ähnlichen Konzepten arbeiten.
Planerisch ist hierbei Bremerhaven sehr weit vorne. Dort wird die Wirtschaft als wichtigster Treiber einer Stadt in den Mittelpunkt eines komplexen Informations- und Unterhaltungssystems gesetzt, um das herum eine innovative Stadt-App – der „Seestadtlotse“ – ein kluges Geflecht aus unterschiedlichstem städtischen Content und User Generated Content webt. Dieses Konzept lebt davon, dass es auf das größte Wissen über den digitalen städtischen Handel aufgebaut ist, das es zurzeit in Deutschland gibt. Jahrelange Planungen und Analysen haben hier eine ausführliche Grundlage geschaffen, die dazu dient, eine möglichst praxisnahe Lösung – sowohl für Anbieter wie auch für Nutzer – generieren zu können. AR-Marketing, Beacons, ein städtischer Online-Shop (der aber fest in der Smartsphere und der digitalen transmedialen Kommunikation integriert ist) sowie das Verständnis für einen agilen Prozess stehen hier im Mittelpunkt. Bremerhaven hat für sich erkannt, dass es digitale Technologien einsetzen muss, um seiner Wirtschaft dabei zu helfen, eine bessere Alternative gegenüber dem rein digitalen Handel zu werden.
Ähnlich geht auch die Stadt Emden vor. Hier jedoch entspricht die Entwicklung einem ganzheitlichen Masterplan – „Digitales Emden“ –, der die Stadt in ihrer Gänze bei der laufenden Digitalisierung fördern soll. Eine Smartsphere ist hier bereits in der konkreten Realisierung, deckt die Bereiche Handel, Tourismus, Kultur und Bürgerbeteiligung ab und wird in einem architektonischen Prozess bedürfnisgerecht modular entwickelt.
Essen ist in 2017 die „Grüne Hauptstadt Europas“, und die Stadt hat sich entschieden, auch in Technologie und Information nachhaltige Wege zu gehen. So wurde eine Smartsphere-App beauftragt, die als Grundlage dazu dienen soll, die Teilnehmer und Besucher der Grünen Hauptstadt 2017 bestmöglich zu informieren und schrittweise in einem Jahr zu lernen, wie eine Smartsphere als Grundlage für die moderne Interaktion zwischen Bürgern/Touristen aufgebaut sein muss.
Außergewöhnlich in Deutschland ist sicherlich auch das „KulturSphäre“-Konzept im Rahmen der „Digitalen Agenda Schleswig-Holstein“. Das Bundesland hat sich dazu entschieden, allen seinen Kulturbetrieben die Möglichkeit zu geben, an diesen innovativen Technologien und Konzepten zu partizipieren und aus diesem Grund im Februar 2017 zwecks Entwicklung einer Smartsphere mit dem Erstellen einer Machbarkeitsstudie begonnen.
Städte und deren Stadtwerke sind zwar der Treiber in der Entwicklung von Infrastruktur, aber auch Unternehmen arbeiten bereits mit Konzepten zur Integration von ortsbasierten Technologien und Diensten.
Leider gehen sie dabei zumeist individuelle Projekte an, anstatt sich mit Kollegen und Konkurrenten zu vernetzen. Nur gemeinsames Lernen und partnerschaftliches Transformieren können noch das Überleben von Einzelhandel und Dienstleistungen ermöglichen. Der Einzelkämpfer hingegen wird zum Opfer von Amazon & Co. werden.
Ein Blick in die (nahe?) Zukunft
Die Richtung, dass wir mehr und mehr von Apps umgeben sind, die wir nicht mehr aktiv aufrufen müssen, sondern die uns stets zur richtigen Zeit genau die Informationen bereitstellen, die wir brauchen, diese Idee ist mit z. B. Google Now schon ein Stück Wirklichkeit geworden.
Unstrittig dürfte sein, dass der Mensch sich mit seiner Technologie nicht in seine vier Wände zurückzieht, sondern sie offensiv nutzt, um damit digitale Duftmarken in seinem analogen Umfeld „On The Go“ zu hinterlassen. Egal, ob diese mit Smartphones, Datenbrillen und -Linsen oder mit uns heute noch nicht vorstellbaren Technologien vorgenommen werden: Der Mehrwert für den Eigentümer, der sich den digitalen Erlebnisraum zu Nutze macht wird, bleibt und wird mit Erfahrung, neuen Konzepten und Technologien sicherlich wachsen. Und sicher ist ebenso, dass auch Unternehmen vermehrt an der Schnittstelle zwischen realer und digitaler Welt agieren müssen, um den Nutzer nachhaltig an sich zu binden.
Artikelbild: Martin Mummel/GRVTY

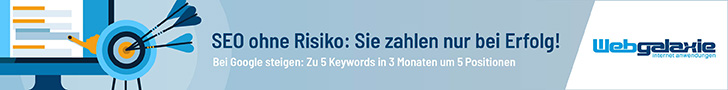







Letzte Reaktionen